Hartz IV steht wie nie zuvor in der Kritik, und das Grundeinkommen wird ernsthaft diskutiert. Es lohnt sich, einen Blick auf den Begriff von Arbeit und auf das Menschenbild zu werfen, das hinter den jeweiligen Positionen liegt.
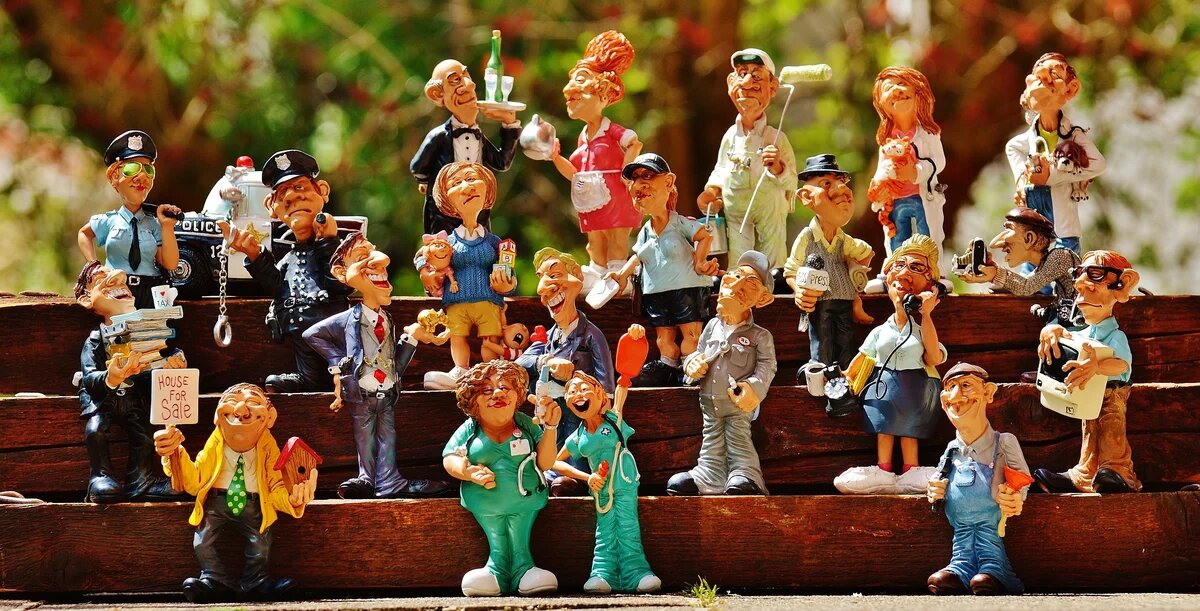
In der politischen Debatte ist jetzt ernsthaft von der Abschaffung von Hartz IV die Rede, und es wird – in verschiedenen Variationen – übers Grundeinkommen nachgedacht. Das ist gut so, vor allem, wenn man sich anschaut, wer da als erster abwehrend die Hände hebt. Christian Lindner kommt allen Ernstes mit dem steinzeitlichen Argument, damit würden diejenigen begünstigt, die gar nicht arbeiten wollen. Das denunziert alle Arbeitssuchenden, vor allem Langzeitarbeitslose, als Faulenzer, passt aber natürlich zur Ideologie der FDP. Friedrich Merz überrascht mit der Mitteilung, Hartz IV sei die bedeutendste Leistung der Regierung Schröder/Fischer gewesen und dürfe auf keinen Fall abgeschafft werden. Der Bild-Zeitung hat er zudem verraten, er halte eine „Agenda für die Fleißigen“ für notwendig. Dazu zählen selbstverständlich auch jene „hart arbeitenden Menschen“, deren Loblied vor etwas mehr als Jahresfrist schon Martin Schulz gesungen hat. Durchaus christlich, ließe sich sagen, denn schon in der Bibel ist die Vertreibung aus dem Paradies mit dem Bann verbunden: „Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen.“
Thema soll hier aber der Rahmen sein, in dem die ernsthafte Diskussion über Hartz IV und das Grundeinkommen geführt wird. Es wird zu Recht über das System der Kontrollen und Sanktionen gesprochen und darauf hingewiesen, dass beides für die Betroffenen entwürdigende Züge trägt. Wer aber auch nur einmal in seinem Leben überhaupt einen Antrag auf das sogenannte Arbeitslosengeld II stellen musste, weiß, dass die Entwürdigung in diesem Moment beginnt, denn man muss sich im übertragenen Sinne vollständig ausziehen, und es wäre durchaus eine Überlegung wert zu prüfen, wie weit sich die Wissbegierde der Job-Center mit den Datenschutzgesetzen vereinbaren lässt. Die Bezeichnung Alg II ist im Übrigen mehrfach irreführend, weil man weder arbeitslos sein muss, um einen solchen Antrag zu stellen, noch zuvor Alg I (das es offiziell gar nicht gibt) bezogen haben muss, sondern das Hartz-IV-Konstrukt eine Sozialhilfe ist, die man nicht bei diesem Namen nennen möchte.
Diese Widersprüchlichkeiten rücken mehr und mehr ins Bewusstsein der politischen Akteure, und nach 13 Jahren Praxis ist das auch allerhöchste Zeit. Interessant wird es, wo über Formen eines Grundeinkommens, bedingungslos oder nicht, debattiert wird; ebenso interessant ist, welche Befürchtungen damit verbunden sind und welches Menschenbild jeweils unausgesprochen dahintersteht.
Ein bedingungsloses Grundeinkommen, darüber könnte man sich vielleicht einigen, ist dann unsinnig, wenn „bedingungslos“ besagen soll, dass es unterschiedslos jeder bekommen sollte. Die CEOs und Vorstandsmitglieder sämtlicher Konzerne dieses Landes würden doch hoffentlich generös abwinken, schon allein wegen der lächerlichen Höhe einer solchen „Bonuszahlung“, und auch Friedrich Merz, Joschka Fischer und Gerhard Schröder würden sich eher gekränkt fühlen durchs Angebot.
„Bedingungslos“ kann aber auch heißen, dass man zwar nach wie vor seine Bedürftigkeit nachweisen, also einen Antrag stellen müsste (wobei das Verfahren selbst die Würde des Antragstellers mehr respektieren sollte als bisher), dass das dann gewährte Grundeinkommen aber nicht mehr an den ständigen Nachweis des Bemühens um Arbeit oder auch nur der Weiterbildung gebunden wäre, vereinfacht gesagt: dass man es den Beziehern eines solchen Einkommens selbst überlässt, was sie in Zukunft aus ihrem Leben machen. Dies entspräche auch dem Ideal des mündigen Bürgers und ist ungefähr, wenn ich ihn richtig verstanden habe, der Ansatz von Robert Habeck. Allerdings will Habeck auch Anreize schaffen, dass die Begünstigten etwas dazu verdienen, also doch möglichst arbeiten gehen.
Seinem Parteifreund Markus Kurth ist das nicht genug. Er ist der Ansicht, ohne das System von Leistung und Gegenleistung gehe es nicht, und mahnt, das Sozialstaatsprinzip nicht mit dem Ausschank von Freibier zu verwechseln (die tageszeitung, 23. 11. 2018). Schon der Vergleich, der ihm hier einfällt, fördert das Bild vom Schmarotzer zutage. Da wäre auch das abgegriffene Bild von der sozialen Hängematte nicht mehr weit. Schon Hartz IV-Kanzler Schröder wusste: „Das Recht auf Faulheit gibt es nicht.“ Vielleicht weiß er nicht, dass Paul Lafargue, Schwiegersohn von Karl Marx, eben dieses Recht auf Faulheit in einem großartigen Essay gleichen Titels propagiert hat, in dem er zugleich die Verherrlichung der Arbeit angreift.
Hiermit wären wir beim gleichsam philosophischen Kern der aktuellen Diskussion. Die Arbeit als Wert an sich, egal wie stumpfsinnig oder gar überflüssig sie ist, ist selbstverständlich in einer Gesellschaft, die immer nach vorn und nach mehr drängt, unantastbar. Mit dem bei uns längst breit durchgesetzten Ideal der Selbstoptimierung besteht auch keine Gefahr, dass man diesen Wert demnächst vom Sockel stoßen könnte. Was aber machen wir mit denen, die nicht mehr arbeiten müssen und deshalb – da wären wir wieder bei Christian Lindner – auch nicht arbeiten wollen?
Und diese Frage bezieht sich nicht etwa auf Millionenerben oder Anteilseigner von Unternehmen, wo sie ja durchaus berechtigt wäre, sondern auf die potentiellen Bezieher eines Grundeinkommens, das dazu ausreicht, keine Angst mehr vor der nächsten Mietfälligkeit oder Stromrechnung zu haben. Natürlich ließe sich denken, dass ein Teil von ihnen die neu gewonnene Sicherheit und Freiheit dazu nutzt, von sich aus neue Projekte anzugehen, ehrenamtliche Arbeit zu leisten, sich weiterzubilden und vieles mehr. Ich nehme an, davon geht auch Robert Habeck aus, bei Markus Kurth bin ich mir da nicht ganz sicher. Dass „Trittbrettfahrerverhalten“ die Solidarität zersetze, schreibt er, sei „eine anthropologische Konstante – von der steinzeitlichen Sippe bis zur linken WG von heute“.
Nun ist die Verklärung der Arbeit zwar ursprünglich ein bürgerlicher Impuls gewesen, als Distinktionsmerkmal gegenüber dem Adel, aber richtig ernst gemacht haben damit erst die Sozialisten. Nicht Marx oder Engels, wohlgemerkt, die von der Abschaffung der Arbeit geträumt haben, damit man „morgens jagen, mittags fischen, abends Viehzucht treiben und nach dem Essen kritisieren“ konnte. Nein, der Held der Arbeit wurde 1928 in der Sowjetunion erfunden und 1938 in „Held der sozialistischen Arbeit“ umbenannt, auch aus der DDR selig ist er noch bekannt. Aus diesen untergegangenen Staaten hat er sich mühelos in die Welt von heute gerettet, als Mitarbeiter der Woche etwa. Zwischen dem Einsatz für den Aufbau des Sozialismus und für die Expansion der Firma ist der Unterschied so groß auch nicht.
Gehen wir einmal davon aus, dass eine ausreichende und nicht an die Bedingung von Arbeitssuche geknüpfte Grundsicherung achtzig Prozent der Begünstigten dazu bewegen würde, sich über kurz oder lang Aktivitäten zuzuwenden, die ihrerseits mehrheitlich wieder der Gesellschaft zugutekommen würden. Denn der Mensch ist keineswegs „von Natur aus faul“, eher im Gegenteil. Nehmen wir dann den Prozentsatz der Alten, die erstmals in der Lage wären, ein altersgerechtes Leben zu führen, weil sie ihre unzureichende Rente nicht mehr mit Zusatzjobs aufstocken müssten (eine Konstellation, die dem Autor dieses Beitrags sehr entgegenkäme).
Dann bliebe in der Tat ein geringer Prozentsatz übrig, der gar nichts täte, in der Terminologie von Markus Kurth „Trittbrettfahrer“, in der von Gerhard Schröder Faulenzer. Gerade sie aber wären, etwas zugespitzt, nach Adornos berühmten Fragment 100 aus den „Minima Moralia“ („Sur l'eau“) die Protagonisten einer befreiten Gesellschaft. Gegen den „ungehemmten, kraftstrotzenden, schöpferischen Menschen“ wendet er sich da, gegen die „blinde Wut des Machens“ und führt weiter aus: „Vielleicht wird die wahre Gesellschaft der Entfaltung überdrüssig und lässt aus Freiheit Möglichkeiten ungenutzt, anstatt unter irrem Zwang auf fremde Sterne einzustürmen.“
Das steht derzeit leider nicht zu hoffen. Dem Einzelnen aber sollte man diese Chance nicht verwehren und ihn nicht dafür stigmatisieren. Zu empfehlen ist in dieser Hinsicht dringend die Lektüre einer Kurzgeschichte des Namensgebers dieser Stiftung: Heinrich Bölls „Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral“.